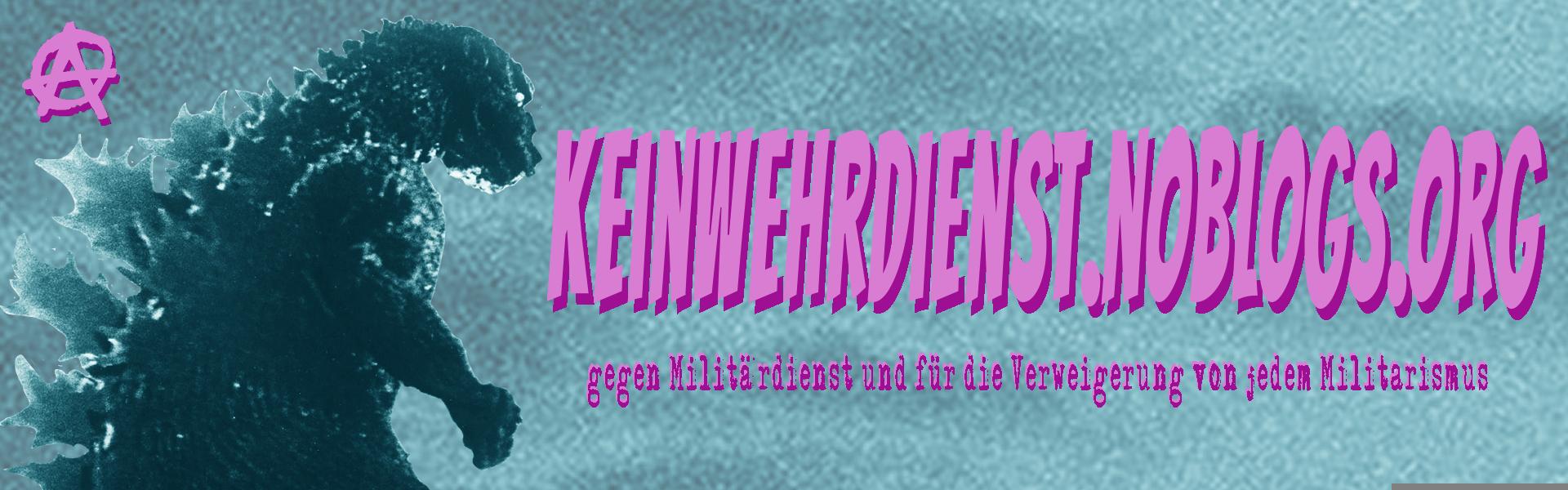Wenn wir unseren Blick auf die Auseinandersetzungen rund um das Thema Wehrfähigkeit und Militärdienst richten, wird deutlich, wie in Politik und Medien eine unbedingte Aufrüstung der Bundeswehr vorbereitet wird. In der Herstellung und Lieferung von Waffen und Kriegsgerät findet diese schon lange statt, aber auch personell soll nun aufgerüstet werden. Die gezeichneten Narrative vermitteln eine unumgängliche Notwendigkeit und begrenzen den Diskurs auf das „Wie“ und „Wann“ ohne den Krieg an sich in Frage zu stellen. „Frieden“ hingegen beruht in den geführten Debatten immer auf der Idee von Nationalstaaten und bedeutet noch lange kein sicheres und freies Leben für alle Menschen. Dieser kapitalistische Frieden meint vor allem den reibungslosen Ablauf von Ausbeutung und Unterdrückung. Der soziale Krieg besteht weiter fort. Wir wollen einen Frieden, der ein gutes Leben für alle bedeutet, ohne kapitalistische, rassistische und patriachale Logiken.
Krieg ist bereits da, die Bedrohung weiterer militärischer Auseinandersetzungen in Europa ist gestiegen, das steht außer Zweifel. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wird strategisch an einem gesellschaftlichen Freund-oder-Feind-Klima gearbeitet: nur wer bereit ist, für die Verteidigung der territorialen Integrität, für die Demokratie, für Europa, für Deutschland zu kämpfen und im Zweifel zu sterben, kann zu uns gehören.
Warum sollte es im Hinblick auf die vermeintliche Bedrohungslage sinnvoll sein einen Wehrdienst abzulehnen? Warum sich der „neuen Realitäten“ verweigern, die von allen Seiten vehement heraufbeschworen werden? Positionen, die eine grundsätzliche Kritik an Aufrüstung und Militarismus äußern sind schon immer marginal. Umso wichtiger finden wir es, uns darin zu positionieren und verschiedene Fragen zu stellen.
Einer der wesentlichen Aspekte fortschreitender Militarisierung ist ein Schließen der Reihen, ein Einschwören auf die nationale Gemeinschaft. Diese Verschiebung geht einher mit einer stetigen Faschisierung, geschlossenen Grenzen, rassistischer Hetze und Queerfeindlichkeit. Das ist kein Zufall. In einem solchen gesellschaftlichen Klima wird die Entscheidung, sich einem Zwangsdienst zu verweigern als moralisch konstruiert; Betroffene müssen sich dem Vorwurf der Gewissenlosigkeit stellen. Der offenen Drohung mit sozialer Isolation und Repression steht auch ein Versprechen gegenüber:
Das Angebot vor allem an die Ausgeschlossenen, die Prekarisierten, endlich akzeptiert und gleichberechtigt zu sein, gebraucht und somit in die Gemeinschaft (die sich vor allem über die Konstruktion einer Bedrohung von außen definiert) aufgenommen zu werden. Sowie ein Sold, der ökonomische Sicherheit verspricht. Und wer sich davon nicht überzeugen lässt – und diese Möglichkeit wird sehr offen diskutiert – der soll eben gezwungen werden. Auch wenn es in Deutschland bis jetzt keinen Zwangsdienst, ob an der Waffe oder in einem der zahllosen kriegsrelevanten ‚zivilen‘ Bereiche, gibt: Jede*r kann im Krisenfall schnell herangezogen werden. Der politische Schritt in Richtung Verpflichtung scheint fast so klein wie die parlamentarische Hürde, eine „ausgesetzte“ Wehrpflicht wieder zu reaktivieren.
Wir wollen uns mit denjenigen zusammentun, die einen anderen Weg zum Frieden und zur Freiheit wählen, als über die kollektive Identität der wehrhaften Nation. Das Gespräch und die Praxis über eine Dekonstruktion des Militarismus – über alle Grenzen und Fronten hinweg – kann dabei helfen, einer Staats- und Machtideologie eine internationale Solidarität entgegenzusetzen. Uns über Praxen der Verweigerung und Zersetzung des Militarismus auf allen Ebenen auszutauschen, gibt uns Kraft und Inspiration. Wir wollen eine Position stärken, die sich der Logik der Aufrüstung und der Militarisierung des Lebens widersetzt. Wir wollen unterschiedliche Perspektiven kennenlernen, die diese vermeintliche Normalität durchbrechen – sei es durch Verweigerung oder andere Formen des Widerstandes.
Im November 2024 haben wir uns bereits in Hamburg zusammengefunden, um uns darüber auszutauschen, wie Menschen in anderen Kontexten gegen die Wehrpflicht kämpfen, wie ihre Realitäten aussehen und welche gesellschaftlichen Auswirkungen sich zeigen. Wir haben gelernt, dass die Existenz eines Wehrdienstes ein Mechanismus ist, der Generation für Generation auf die militaristische Logik einschwört. Es ist ein Apparat, der auf Jahrhunderte alte Strategien der Unterwerfung und Unterdrückung zurückgreift, wobei Rassismus und Patriarchat als Bindemittel dienen. Dies steht sozialer Befreiung fundamental entgegen. Aus anarchistischer Sicht geht es im Widerstand gegen die Einführung der Wehrpflicht und die Militarisierung also nicht bloß um die Verteidigung erkämpfter und errungener Rechte der Selbstbestimmung. Vielmehr geht es auch um die Frage, wie wir dem nationalistischen Rollback eine internationalistische, kämpferische Perspektive entgegensetzen können. Wir werden keine kriegslegitimierenden und autoritären Positionen akzeptieren und ihnen subversive solidarische Praxen entgegen setzen.
Deswegen freuen wir uns, das Wochenende vom 14.-16. November 2025 wieder zu einem Moment des Austauschs zu machen – Mitstreiter*innen aus verschiedenen Teilen der Welt werden ihre Projekte vorstellen und ihre Erfahrungen und Analysen mit uns teilen.
Auch laden wir dazu ein, wieder schriftliche Beiträge einzureichen, die wir nach dem Event in einer Broschüre veröffentlichen werden!