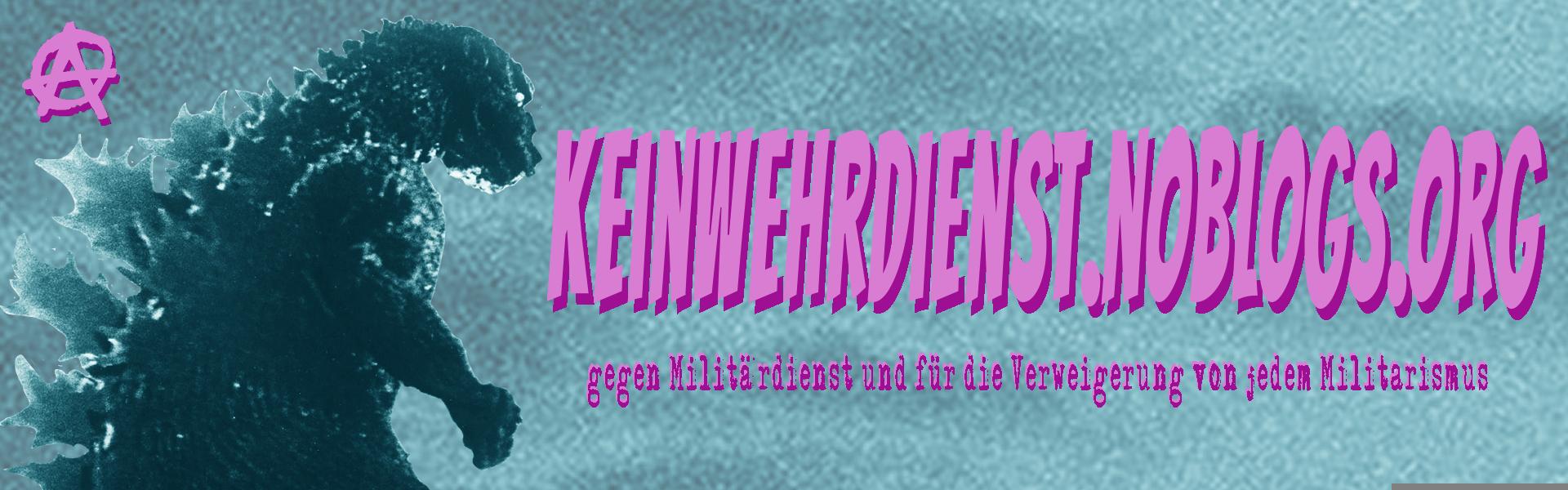Wenn wir unseren Blick auf die Auseinandersetzungen rund um das Thema Wehrfähigkeit und Militärdienst richten, wird deutlich, wie in Politik und Medien eine unbedingte Aufrüstung der Bundeswehr vorbereitet wird. In der Herstellung und Lieferung von Waffen und Kriegsgerät findet diese schon lange statt, aber auch personell soll nun aufgerüstet werden. Die gezeichneten Narrative vermitteln eine unumgängliche Notwendigkeit und begrenzen den Diskurs auf das „Wie“ und „Wann“ ohne den Krieg an sich in Frage zu stellen. „Frieden“ hingegen beruht in den geführten Debatten immer auf der Idee von Nationalstaaten und bedeutet noch lange kein sicheres und freies Leben für alle Menschen. Dieser kapitalistische Frieden meint vor allem den reibungslosen Ablauf von Ausbeutung und Unterdrückung. Der soziale Krieg besteht weiter fort. Wir wollen einen Frieden, der ein gutes Leben für alle bedeutet, ohne kapitalistische, rassistische und patriachale Logiken.
Krieg ist bereits da, die Bedrohung weiterer militärischer Auseinandersetzungen in Europa ist gestiegen, das steht außer Zweifel. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wird strategisch an einem gesellschaftlichen Freund-oder-Feind-Klima gearbeitet: nur wer bereit ist, für die Verteidigung der territorialen Integrität, für die Demokratie, für Europa, für Deutschland zu kämpfen und im Zweifel zu sterben, kann zu uns gehören.
Warum sollte es im Hinblick auf die vermeintliche Bedrohungslage sinnvoll sein einen Wehrdienst abzulehnen? Warum sich der „neuen Realitäten“ verweigern, die von allen Seiten vehement heraufbeschworen werden? Positionen, die eine grundsätzliche Kritik an Aufrüstung und Militarismus äußern sind schon immer marginal. Umso wichtiger finden wir es, uns darin zu positionieren und verschiedene Fragen zu stellen.
Einer der wesentlichen Aspekte fortschreitender Militarisierung ist ein Schließen der Reihen, ein Einschwören auf die nationale Gemeinschaft. Diese Verschiebung geht einher mit einer stetigen Faschisierung, geschlossenen Grenzen, rassistischer Hetze und Queerfeindlichkeit. Das ist kein Zufall. In einem solchen gesellschaftlichen Klima wird die Entscheidung, sich einem Zwangsdienst zu verweigern als moralisch konstruiert; Betroffene müssen sich dem Vorwurf der Gewissenlosigkeit stellen. Der offenen Drohung mit sozialer Isolation und Repression steht auch ein Versprechen gegenüber:
Das Angebot vor allem an die Ausgeschlossenen, die Prekarisierten, endlich akzeptiert und gleichberechtigt zu sein, gebraucht und somit in die Gemeinschaft (die sich vor allem über die Konstruktion einer Bedrohung von außen definiert) aufgenommen zu werden. Sowie ein Sold, der ökonomische Sicherheit verspricht. Und wer sich davon nicht überzeugen lässt – und diese Möglichkeit wird sehr offen diskutiert – der soll eben gezwungen werden. Auch wenn es in Deutschland bis jetzt keinen Zwangsdienst, ob an der Waffe oder in einem der zahllosen kriegsrelevanten ‚zivilen‘ Bereiche, gibt: Jede*r kann im Krisenfall schnell herangezogen werden. Der politische Schritt in Richtung Verpflichtung scheint fast so klein wie die parlamentarische Hürde, eine „ausgesetzte“ Wehrpflicht wieder zu reaktivieren.
Wir wollen uns mit denjenigen zusammentun, die einen anderen Weg zum Frieden und zur Freiheit wählen, als über die kollektive Identität der wehrhaften Nation. Das Gespräch und die Praxis über eine Dekonstruktion des Militarismus – über alle Grenzen und Fronten hinweg – kann dabei helfen, einer Staats- und Machtideologie eine internationale Solidarität entgegenzusetzen. Uns über Praxen der Verweigerung und Zersetzung des Militarismus auf allen Ebenen auszutauschen, gibt uns Kraft und Inspiration. Wir wollen eine Position stärken, die sich der Logik der Aufrüstung und der Militarisierung des Lebens widersetzt. Wir wollen unterschiedliche Perspektiven kennenlernen, die diese vermeintliche Normalität durchbrechen – sei es durch Verweigerung oder andere Formen des Widerstandes.
Im November 2024 haben wir uns bereits in Hamburg zusammengefunden, um uns darüber auszutauschen, wie Menschen in anderen Kontexten gegen die Wehrpflicht kämpfen, wie ihre Realitäten aussehen und welche gesellschaftlichen Auswirkungen sich zeigen. Wir haben gelernt, dass die Existenz eines Wehrdienstes ein Mechanismus ist, der Generation für Generation auf die militaristische Logik einschwört. Es ist ein Apparat, der auf Jahrhunderte alte Strategien der Unterwerfung und Unterdrückung zurückgreift, wobei Rassismus und Patriarchat als Bindemittel dienen. Dies steht sozialer Befreiung fundamental entgegen. Aus anarchistischer Sicht geht es im Widerstand gegen die Einführung der Wehrpflicht und die Militarisierung also nicht bloß um die Verteidigung erkämpfter und errungener Rechte der Selbstbestimmung. Vielmehr geht es auch um die Frage, wie wir dem nationalistischen Rollback eine internationalistische, kämpferische Perspektive entgegensetzen können. Wir werden keine kriegslegitimierenden und autoritären Positionen akzeptieren und ihnen subversive solidarische Praxen entgegen setzen.
Deswegen freuen wir uns, das Wochenende vom 14.-16. November 2025 wieder zu einem Moment des Austauschs zu machen – Mitstreiter*innen aus verschiedenen Teilen der Welt werden ihre Projekte vorstellen und ihre Erfahrungen und Analysen mit uns teilen.
Auch laden wir dazu ein, wieder schriftliche Beiträge einzureichen, die wir nach dem Event in einer Broschüre veröffentlichen werden!
Monat: November 2025
Second International Meeting Against Military Service and for the Refusal of All Militarism14–16 November 2025 / Hamburg
When we look at the ongoing debates around military readiness and conscription, it becomes clear how politics and the media are preparing the ground for the unconditional rearmament of the German military. This has long been happening in the production and export of weapons and war machinery, but now the push is also toward recruiting more personnel. The dominant narratives portray this as an unavoidable necessity, narrowing public discussion to questions of “how” and “when”—without ever questioning war itself.
“Peace,” in these debates, always rests on the idea of nation-states and by no means guarantees a safe or free life for everyone. This capitalist peace primarily means the smooth functioning of exploitation and oppression. The social war continues. We want a peace that means a good life for all—free from capitalist, racist, and patriarchal logics.
War is already here. The threat of further military conflict in Europe has increased—there is no doubt about that. Since the beginning of the war in Ukraine, a friend-or-foe mentality has been strategically cultivated: only those who are willing to fight and, if necessary, die for the defense of territorial integrity, for democracy, for Europe, for Germany, are considered part of “us.”
Why, then, should it make sense to reject military service in light of the alleged threat? Why refuse the so-called “new realities” that are being so vehemently invoked from all sides? Positions expressing a fundamental critique of militarization and rearmament have always been marginalized. All the more reason for us to take a stand and ask difficult questions.
One of the key aspects of advancing militarization is the closing of ranks—an oath of loyalty to the national community. This shift goes hand in hand with a steady process of fascization, fortified borders, racist agitation, and queerphobia. None of this is accidental. In such a social climate, the decision to refuse compulsory service is constructed as a moral failure; those affected must face accusations of lacking conscience.
Alongside open threats of social isolation and repression, there is also a promise: an offer—especially to the excluded and precarious—to finally be accepted and treated as equals, to be needed, and thus included in the national community (a community that defines itself primarily through the construction of an external threat). This comes with a salary that promises economic stability. And those who cannot be persuaded—an option discussed quite openly—are simply to be forced.
Even though Germany currently has no compulsory service—neither with weapons nor in one of the countless “civilian” but war-relevant sectors—anyone can be called up quickly in a crisis. The political step toward such obligations seems almost as small as the parliamentary hurdle to reactivate the “suspended” draft.
We want to join forces with those who choose a different path to peace and freedom—one that does not rely on the collective identity of a “defensive nation.” Conversations and shared practices around the deconstruction of militarism—across all borders and frontlines—can help us confront state and power ideologies with international solidarity.
Exchanging experiences of refusal and subversion of militarism at every level gives us strength and inspiration. We want to strengthen a position that resists the logic of rearmament and the militarization of everyday life. We want to hear and learn from different perspectives that break through this supposed normality—whether through acts of refusal or other forms of resistance.
In November 2024, we already gathered in Hamburg to exchange ideas about how people in other contexts are resisting conscription, what their realities look like, and what social consequences they face. We learned that the existence of conscription is a mechanism that indoctrinates generation after generation into militaristic logic. It is an apparatus rooted in centuries-old strategies of domination and oppression, held together by racism and patriarchy. This fundamentally contradicts any project of social liberation.
From an anarchist perspective, resistance against the reintroduction of conscription and against militarization is not merely about defending the hard-won right to self-determination. It is also about how we can oppose the nationalist rollback with an internationalist and combative perspective. We will not accept war-justifying or authoritarian positions—we will confront them with subversive and solidaristic practices.
That is why we are once again looking forward to making the weekend of 14–16 November 2025 a moment of collective exchange—comrades from different parts of the world will present their projects and share their experiences and analyses with us.
We also invite you to submit written contributions once again, which we will publish in a brochure after the event!